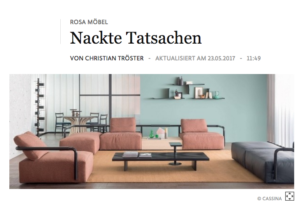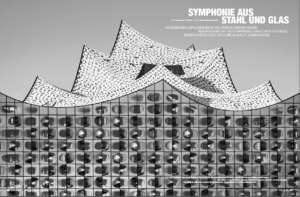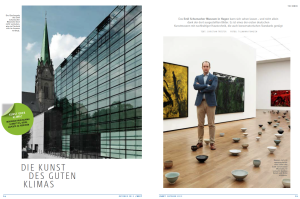FAZ 12.2.2017 Dank neuer Apps kann sich jeder als Innenarchitekt versuchen. Doch halten die zahlreichen Programme, was sie versprechen? Ein Selbstversuch.
FAZ 12.2.2017 Dank neuer Apps kann sich jeder als Innenarchitekt versuchen. Doch halten die zahlreichen Programme, was sie versprechen? Ein Selbstversuch.
Sie heißen Roomle, Roomplanner oder Home Design 3D, und ihr Versprechen ist magisch: Ruck, zuck entwirfst du auf deinem Tablet-Computer einen Grundriss, platzierst darin Möbel, Leuchten und Teppiche und schaust dir das Ganze als Animation in Farbe und 3D auf dem Bildschirm an. So kann deine Wohnung bald aussehen, und wenn’s nicht gefällt, werden die Möbel in der Darstellung einfach ausgewechselt.
Was bis vor kurzem noch das Handwerkszeug weniger Spezialisten war, erscheint auf einmal massentauglich. Mit den passenden Apps können auch Hausfrauen, Studenten oder Journalisten mit zwei linken Händen sich als Interior Designer fühlen. Wo gestern mit Zollstock und Wasserwaage hantiert wurde, soll nun ein Tablet-Computer das Werkzeug sein: Mit ein paar Fingerwischs entstehen nicht nur neue Wohnwelten, sondern auch noch die passenden Visualisierungen.
Doch wer einmal versucht hat, seine neue Windows-Version mit alten Grafikkarten zu synchronisieren oder sich mit unausgereifter Software auf seinem Smartphone herumgeschlagen hat, weiß, dass gegenüber den Verheißungen auch Misstrauen angebracht ist: Famose Demo-Videos zeigen allzu oft eine geschönte Version der Wirklichkeit.
Also ausprobieren. Wir haben uns einige der gängigen Einrichtungs-Apps auf einem iPad Pro angeschaut. Dieselben oder vergleichbare Programme gibt es auch für Android-Smartphones und Tablets. Neben beschränkten Basisversionen gibt es meist Versionen mit deutlich erweitertem Funktionsumfang für Preise zwischen 10 und 20 Euro.
Die bestechendste Funktion der Programme heißt Augmented Reality und funktioniert folgendermaßen: Man richtet aus der entsprechenden App heraus die Kamera in einen Raum, zieht aus der Randspalte die Abbildung eines Möbelstücks in den Raum und – voilà – da steht dann der neue Stuhl im eigenen Wohnzimmer. Und nicht nur das. Man kann – weil es sich bei der Abbildung nicht um ein Foto, sondern um einen Datensatz zur dreidimensionalen Darstellung handelt – das Modell drehen und so im Raum ausrichten, wie man möchte.
Anschließend kann man mit dem iPad als Sichtfenster um das Objekt herumgehen und es samt seiner neuen Umgebung von allen Seiten betrachten. Das ist spektakulär und funktioniert zum Beispiel gut mit der App „Pair“. Zwar fliegen die ausgewählten Möbel in unserem Test zunächst wie Luftballons durch den Raum, doch mit ein bisschen Übung hat man die Technik im Griff. Am Ende jedenfalls steht ein virtueller Stuhl gleichberechtigt neben einem echten im Bild. „Seit zwanzig Jahren“, kommentiert Christian Zöllner von der Visualisierungsagentur Bloomimages in Hamburg, „reden alle davon, dass Augmented Reality anwendungsreif sei, doch lange passierte wenig. Jetzt scheint es eine Technik für jedermann zu werden.“
Funktioniert die Technik auch gut, ein Knackpunkt von „Pair“ ist die Auswahl der Möbel. Alle gewählten Modelle kann man im Prinzip mit einem Klick im Internet bestellen. Doch stellt „Pair“ nur zu amerikanischen Online-Shops durch, so dass man nicht einmal Möbel des deutschen Herstellers Vitra erwerben kann. Die Verknüpfung von Interior-Design mit realen Produkten, was eigentlich der wahr gewordene Traum eines jeden Produzenten sein müsste, entpuppt sich als die Schwachstelle in allen getesteten Apps. Es klappt einfach nicht.
Bei der App „Living Room“ von Oleksander Rysenko zum Beispiel, stammen die Möbel überwiegend von Ikea. Doch der Hersteller scheint hier nicht mit an Bord zu sein, die App ist kein Katalog, eine größere Auswahl von Modellen ist nur in der Bezahlversion für 19,99 € erhältlich. Dafür gibt es im Menu die charmante Zusatzinformation „Raumdekoration Kosten“. Die werden in unserem Beispiel mit 6544 Euro angegeben. An den Sesseln Sosta (je 59,99 Euro) und der Stehleuchte Kvart (39,99 Euro) kann das nicht liegen, das Sofa Exarby ( zweimal 65 Euro) ist in Deutschland ohnehin nicht erhältlich. Vielleicht liegt es aber auch am Kamin, Modell Napoleon Georgia für 844 Euro, der nicht von Ikea stammt. Ein Blick auf die virtuelle Rechnung zeigt zudem erschreckende 4220 Euro für Bodenbeläge und Wände. Wir wissen nicht, wie diese Summe zustande kam und ob wir diese Kalkulation für falsch oder für realistisch halten sollen. Unklare und überraschend hohe Kosten beim Einrichten kommen uns andererseits seltsam bekannt vor – deshalb an dieser Stelle keine Einwände.
Auch wenn die meisten Apps in Sachen Möbelkauf noch nicht funktionieren, wird ihr großes Potential deutlich. Sie können den Innenarchitekten-Entwurf mit konkreten Produkten und Kalkulationen verknüpfen und auf diese Weise die Digitalisierung der gesamten Kette vom Design über die Produktion bis zum Handel revolutionieren. In vielen Branchen wird so etwas unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ diskutiert. Wie es schon heute geht, zeigt als einer der wenigen der polnische Regalhersteller Tylko. Er bietet ein Regal an, das man in Höhe, Breite, Material und Fächeraufteilung in der gleichnamigen App selbst konfiguriert. Anschließend kann man das maßgeschneiderte Modell mittels Augmented Reality im eigenen Zimmer visuell überprüfen und bei Gefallen direkt ordern. Die Lieferzeit beträgt laut Hersteller vier bis sechs Wochen.
Unabhängig von Augmented Reality und Instant-Konsum bieten die besten unter den Einrichtungs-Apps Gestaltungsfunktionen bis hin zum Entwurf eines ganzen Hauses an. Wir haben in der App Roomle ohne Vorbereitung mit dem Finger einen Grundriss auf dem iPad gezeichnet. Doch nur mit Geschick ist es möglich, die gewünschten Maße exakt zu erreichen. Außerdem verschieben sich die Wände oft beim Anfügen von Fenstern oder Türen, das ganze System scheint nicht eingestellt auf die Möglichkeiten einer ungeübten Hand. Doch nach einer kleinen Einarbeitung finden wir eine Maske, in der man die gewünschten Daten eintragen kann – die Wände richten sich entsprechend aus.
Nachdem der Grundriss samt Fenstern und Türen installiert ist, wagen wir uns an die Einrichtung. Als Problemfall erweist sich der Teppich, der, obwohl seine Maße identisch mit dem Zimmer sind, nicht passt. Womöglich ein Anfängerfehler unsererseits, einer von vielen: Im ersten Anlauf rutschen uns die Fenster auf die Scheuerleisten und alle Stühle schauen gegen die Wand – alles Probleme, die sich als lösbar erwiesen. Schon im zweiten Anlauf gelingt uns ein Ambiente, bei dem wir alles wie gewünscht plazieren können. Auch die Auswahl der Wand- und Teppichfarben ist zufriedenstellend, schließlich installierten wir als Wandschmuck noch ein Bild, das wir in Größe und Position anpassen können und sind zufrieden.
Bei der App „Home Design 3D“ machen wir uns den Start leichter und wählen als Ausgangspunkt einen vorgegebenen Modellraum. Den wollen wir nach eigenem Geschmack variieren. Etwas Verwirrung verursacht zunächst der Versuch, Tapetenmuster und Bodenbeläge zu installieren. Doch die Lösung ist so einfach, dass wir zunächst nicht darauf gekommen sind: Man zieht die gewünschten Muster einfach auf die entsprechenden Flächen. Zudem kann man bei „Home Design 3D“ eigene Fotos zum Beispiel für den Wandschmuck importieren. Charmant ist eine Option für Lichtstimmungen: Der Einfall des Tageslichts wird, je nach Tageszeit, verblüffend realistisch dargestellt. Wie auch bei Roomle sind die Maße der Objekte variabel, man kann also zum Beispiel ein Sofa genauso abmessen, wie man es braucht – wobei man dann im Ernstfall genauso eins auch finden müsste. Für den Raumeindruck jedoch ist das Verfahren hilfreich. „Home Design 3D“ erweist sich als brauchbare App, die in der Funktionalität sehr ähnlich ist wie Roomle.
Herausragend dagegen kommt uns die App „Room Planner“ vor. Sie stammt von dem Unternehmen Chief Architect und man merkt ihr den professionellen Hintergrund an. „Room Planner“ kombiniert eigene Raumentwürfe mit Elementen von Augmented Reality. Hat man einen Raum eingerichtet, was in etwa so funktioniert wie bei den zuvor genannten Programmen, kann man sich bei „Room Planner“ mit dem iPad in dem virtuellen Raum bewegen. Man trägt dazu das Tablet wie einen Rahmen vor sich her. Wenn man sich damit nach rechts dreht, sieht man den Küchentresen, dreht man sich nach links, erscheint die Sitzecke, in der man gerade mit einem Fingerwisch ein neues Sofa plaziert hat. Man kann sich ihm nähern und es umkreisen. Das vermittelt nicht nur eine lebendige räumliche Erfahrung, sondern auch den Eindruck, man sei technisch auf der Höhe der Zeit.
Mit den beschriebenen Einschränkungen sind die Apps alltagstauglich. Sie erfordern allerdings eine Einarbeitungszeit, die sich für eine einmalige Nutzung kaum lohnen dürfte. Auch bleiben die Bilder atmosphärisch oft kalt. Materialien, Oberflächen und Lichtstimmungen – also all das, was Wohnlichkeit ausmacht – bilden sie nicht befriedigend ab. Christian Zöllner hält dieses Problem jedoch für lösbar: „Es wird darauf hinauslaufen, dass die Rechenleistung ausgelagert wird. Die Daten werden zu einem Großrechner geschickt, von dort bekommt der Nutzer ein hochauflösendes Bild mit guten Texturen.“ Es scheint, als könnten sich die Apps, neben Bleistift und Zollstock, einen sicheren Platz als Planungshilfe erobern – für Bastler, Träumer und Handwerker.
 Ideat 2/2018 Beim Mondrian Hotel in Doha griff Marcel Wanders in die Vollen. Dem Niederländer gelang damit ein ästhetisches Spektakel, dass zwischen arabischen Bling Bling und Alice im Wunderland changiert. Der Spaßfaktor ist garantiert.
Ideat 2/2018 Beim Mondrian Hotel in Doha griff Marcel Wanders in die Vollen. Dem Niederländer gelang damit ein ästhetisches Spektakel, dass zwischen arabischen Bling Bling und Alice im Wunderland changiert. Der Spaßfaktor ist garantiert.