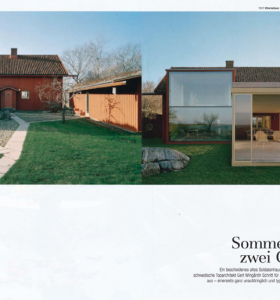Wirtschaftswunder und Wiederaufbau werden nicht unbedingt mit überbordender Phantasie in Verbindung gebracht. Doch was im Westdeutschland der Nachkriegsjahre an Sakralbauten entstand, kann durchaus als ein Architekturwunder gefeiert werden. Eines, das den Vergleich mit spektakulären Großbauten der Gegenwart nicht zu scheuen braucht. Denn die deutschen Kirchen der 50er- und 60er-Jahre, das zeigt ein genauerer Blick, sind gestalterische Juwelen und Zeichen von Freiheit und Aufbruch. Was für erregende Formen, was für magische Räume haben die Baumeister jener Jahre entworfen – vom Zeltdach bis zum spannungsvollen Betongebirge. Was für Lichteffekte haben sie, oft im Zusammenspiel mit Künstlern, integriert. Und was für Mengen von Kirchen sind da entstanden! Von 1948 bis Anfang der 60er-Jahre wurden in der Bundesrepublik Deutschland rund achttausend Sakralbauten errichtet – mehr als in den vierhundert Jahren zuvor. Der Grund für den erstaunlichen Bauboom: Zerstörungen des Krieges, moderne Bautechniken, der Wohlstand der Wirtschaftswunderjahre und eine Suche nach Sinn, auf der man hoffte, in den Kirchen eine Antwort zu finden. Die besten Architekten des Landes, darunter die beiden einzigen deutschen Pritzker-Preisträger, Gottfried Böhm und Frei Otto, arbeiteten an diesem Architekturwunder mit. Auch Sep Ruf, Egon Eiermann, Hans Scharoun und Paul Schneider-Esleben – hoch geschätzte und international renommierte Baumeister – haben in jenen Jahren sakrale Räume geschaffen. In vielen Provinzgemeinden und Wohnvierteln stehen so Meisterwerke, die sich heute nur noch Metropolen an zentraler Stelle leisten würden, und warten auf ihre Wiederentdeckung. Da ist die wulstige Kirche St. Rochus in Düsseldorf, die von Paul Schneider-Esleben 1954 realisiert wurde. Mit ihrer dreigeteilten eiförmigen Kuppel sorgt sie bis in die Gegenwart hinein immer wieder für Kontroversen. Da sind die Betongebirge von Gottfried Böhm in Saarbrücken, Neviges und Köln, die eher an Großplastiken als an funktionale Räume erinnern. Und selbst heute vergessenen Architekten wie Georg Rasch und Winfried Wolsky gelangen so spektakuläre Orte wie der der Auferstehungskirche in Köln-Buchforst (1965 bis 1968). Von der Spitze einer Pyramide fällt dort Licht durch eine verglaste Fuge in den Raum. Es inszeniert und u?berh.ht auch die Betonwände und deren kräftige Struktur. „Kein Architekturzweig entwickelt so zukunftsweisende, moderne Bauformen wie der Kirchenbau“, bemerkte bereits 1963 „Der Spiegel“. Und wunderte sich zugleich: „Moderne Architektur, die einst von der Kathedrale des Sozialismus, dem Dessauer Bauhaus, ausgegangen ist, findet heute im Kirchenbau mehr Spielraum der Phantasie als im profanen Bau.“ Das große Vorbild fu?r die Nachkriegskirchen war die Pilgerkirche Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp von Le Corbusier…