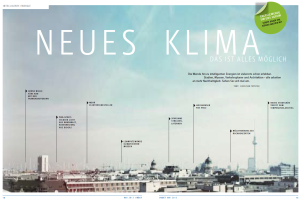Galleria Messe Frankfurt Magazin 1/2013
Galleria Messe Frankfurt Magazin 1/2013
1963 trafen sich Adenauer und de Gaulle, um zwischen ihren Ländern die alte Feindschaft zu begraben und das Gespräch zu eröffnen. Dieser Geist wirkt noch heute – auch im Design.
von Christian Tröster
Er war eine Ikone deutschen Designs: Der Mercedes „/8“ , gesprochen Strich-Acht. Er wurde mehr verkauft als alle anderen Daimler Modelle der Nachkriegszeit zusammen, prägte das Bilder der westdeutschen Straßen in den Siebzigern und wurde zum Inbegriff deutschen Designs weltweit. Nur, den Strich-Achter hatte ein Franzose entworfen. Der hieß Paul Bracq, hatte als junger Mann bei Citroen gearbeitet und war 1957 nach Sindelfingen gewechselt. „Bracq brachte“, so Klaus Klemp vom Museum für angewandte Kunst in Frankfurt, „französische Eleganz ins deutsche Autodesign“. Neben dem „/8“ gestaltete er auch den Mercedes 600 und den sogenannten Pagoden-SL: legendäres Design und das Ergebnis deutsch-französischer Kooperation.
Die Arbeit des Designers, der später auch noch für Peugeot und BMW arbeiten sollte, ist vielleicht der schönste Beweis dafür, dass der Élysée-Vertrag von 1963 mehr war als ein folgenloser Akt von Bürokraten. Er war der Meilenstein eines wachsenden Austausches und Zeichen immer dichter werdender Beziehungen. Und, das natürlich auch, ein politisches Wunder nach drei erbittert geführten Kriegen.
Heute, am fünfzigsten Jahrestag des Élysée-Abkommens, arbeiten deutsche und französische Designer so selbstverständlich für Firmen des Nachbarlandes, als wäre es nie anders gewesen. Dafür steht nicht nur Karl Lagerfeld, der zum Monument deutsch-französischer Inspiration geworden ist, sondern auch zahlreiche bekannte und unbekannte Designer im Alltag. So hat Torsten Neeland Objekte für das Pariser Designlabel Mouvements Modernes entworfen, Michael König eine Uhr für Ligne Roset und Mathias Hahn eine Lampe für den gleichen Hersteller. Im Gegenzug arbeiten aus Frankreich Patrick Nadeau und Jean-Marie Massaud für die deutsche Haushaltswarenmarke Authentics, Christophe de la Fontaine entwarf für Rosenthal das Service „Format“, bei Vitra sind Produkte der Gebrüder Bouroullec im Programm. So intensiv ist der Austausch geworden, dass darüber die nationalen Traditionen zu verschwimmen drohen, nicht nur zwischen den beiden Nachbarländern. Schließlich leben viele der genannten Designer in Mailand oder London und produzieren auch für Auftraggeber in China und den USA. Gibt es also in einer globalisierten Wirtschaft noch ein deutsches und französisches Design?
Ganz gewiss, findet Klaus Klemp. Der Kunsthistoriker hat gerade eine Ausstellung über Haushaltsgeräte französischer Designerinnen im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst organisiert und sagt: „In Frankreich sind die Wohnungen ein wenig anders eingerichtet als bei uns, da gibt es noch viel mehr Dekorationen. Da lebt noch das Barock und eine katholische Tradition. Es gibt eine Freude an Farben, Formen und auch ein Bewußtsein für Vergänglichkeit. Bis heute kommen viele große französische Gestalter vom Interior-Design. Philippe Starck hat zuerst Hotels eingerichtet.“ Das deutsche Design dagegen sieht Klemp eher vom Protestantismus geprägt: „Da will man Dinge auf ihre Grundformen zurückführen und etwas für immer und ewig erfinden“. Dieser Einschätzung stimmt auch Olivia Putman zu. Die Designerin, Tochter und Nachfolgerin der großen Andrée Putman, kuratiert auf der Ambiente 2013 eine Schau über aktuelles Design aus ihrer Heimat und sagt: „Viele französische Designer verbinden das Können von Kunsthandwerkern mit der Kreativität modernen Designs. Das erlaubt eine Vielzahl von Oberflächen und führt zu einem breiten Ausdrucksspektrum“. Das deutsche Design sieht sie ganz anders positioniert: „Es steht für Genauigkeit und Qualität“, historisch in Positionen von Peter Behrens, Mies van der Rohe und Dieter Rams: „Ich liebe die Intelligenz ihrer Arbeiten. Sie schaffen eine Balance zwischen Effizienz, Schönheit und Funktionalität“.
Putmans Verweis auf die Vorkriegsmoderne zeigt auch, dass es bereits lange vor dem Élysée-Vertrag einen wechselseitige Inspiration gab – trotz der Feindschaft beider Länder auf politischer Ebene. Le Corbusier hatte 1910 bei Peter Behrens ins Berlin hospitiert und dort auch Walter Gropius und Mies van der Rohe kennengelernt. Der Austausch zwischen ihnen fand seinen Ausdruck später in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung. An dem Wohnungsbauprojekt arbeiteten 1927 Gropius, Mies van der Rohe und Le Corbusier zusammen und schufen, gemeinsam mit Architekten aus Holland, Belgien und der Schweiz ein Ensemble, das wie kein anderes zuvor den Geist der Moderne materialisert. In nur 21 Wochen Bauzeit entstanden 21 kubische Häuser mit insgesamt 63 Wohnungen, wobei die Architekten nicht nur für das Bauen, sondern auch für die Einrichtung der Wohnungen verantwortlich waren. Gemeinsamkeiten zeigen sich hier bei den Stahlrohmöbeln von Charlotte Perriand und denen von Marcel Breuer und Mies van der Rohe.
Nach dem Krieg wurde französisches Design in Deutschland vor allem mit Mode assoziiert, eine Idee, der auch die Verpflichtung des Modedesigners Pierre Cardin für die deutsche Porzellanmarke Hutschenreuther folgte. 1985 entwarf er für die Firma das Service Maxim’s de Paris. Doch dieses grenzüberschreitende Engagement wirkte wie aus der Zeit gefallen. Sowohl für Cardin als auch für den Porzellanhersteller lagen die großen Zeiten schon zwanzig Jahre zurück. Die Zukunft gehörte anderen. Der aufsteigende Stern jener Jahre hieß Philippe Starck, der da gerade die Privaträume des damaligen Präsidenten Mitterand im Elysée-Palast ausgestattet hatte. Das war für ihn der Startpunkt einer weltweiten Karriere, zu der bis heute, ganz selbstverständlich, auch viele Produkte für deutsche Firmen gehören.
Der Élysée-Vertrag
Vielleicht bedurfte es zweier besonders großer Politiker um etwas besonders Einfaches zu beschließen: Miteinander zu sprechen. Denn das, was Konrad Adenauer und Charles de Gaulle 1963 im Élysée-Palast, dem Amtsitz des französischen Präsidenten, unterschrieben, war keine Beschreibung gegenseitiger Zahlungen oder Verpflichtungen. Sondern vor allem das Versprechen, von nun an regelmäßig miteinander zu reden. Die Minister beider Länder, voran die Außenminister, sollten sich von nun an alle drei Monate zusammensetzen und über Außen-, Sicherheits-, Jugend- und Kulturpolitik sprechen – eine Maßmahme, die wahre Wunder für den Frieden und die europäische Einigung bewirkte. „Zwar hatte die deutsch-französische Aussöhnung schon früher begonnen“, erinnerte sich der deutsche Außenminister Dietrich Genscher, „aber es war ein ganz entscheidender Meilenstein, weil nun dieser Beziehung eine langfristige Ausrichtung gegeben wurde. Die Erwartungen, die man damals mit diesem Vertrag verbunden hat, haben sich voll erfüllt“.